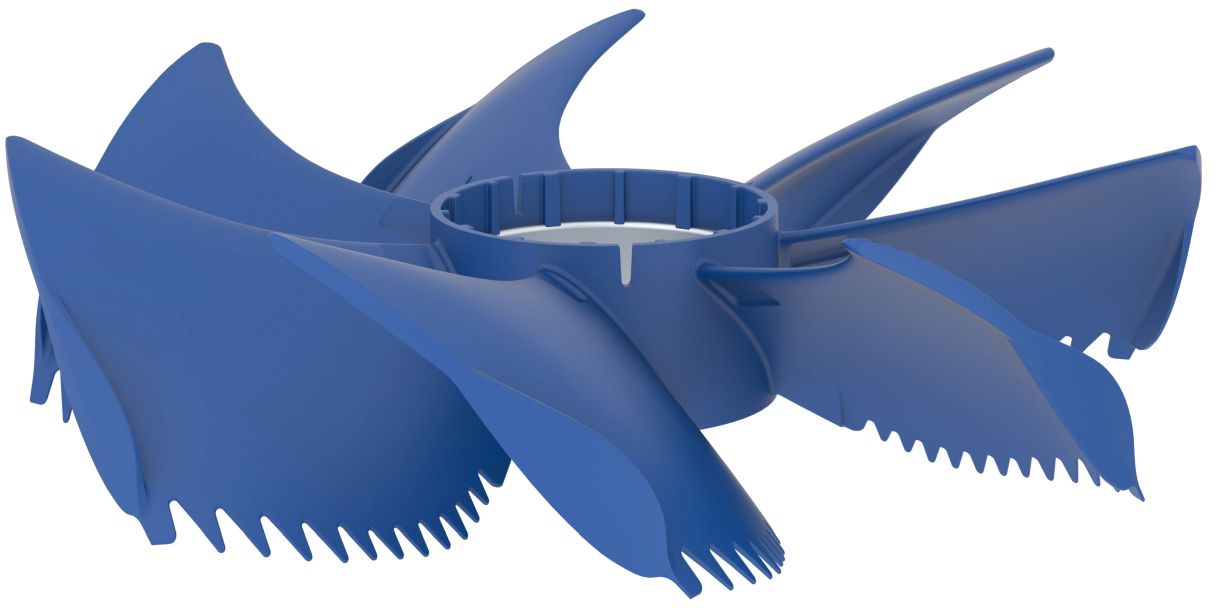Nachhaltige und gesunde Lebensmittelversorgung neu denken
Eine der großen Herausforderungen unserer Zeit besteht darin, die wachsende Bevölkerung zu ernähren und gleichzeitig unseren Planeten zu erhalten. Daher sind effiziente Prozesse und Verfahren gefragt. Gleichzeitig wünschen sich Verbraucherinnen und Verbraucher gesunde, schmackhafte und bezahlbare Lebensmittel. Proteine hergestellt aus Bierhefe zeichnen sich durch ausgezeichnete funktionelle Eigenschaften wie die gute Umsetzung in Muskelmasse, die hervorragende Texturbildung, ein ansprechendes Geschmacksprofil sowie Allergenfreiheit aus. Daher sind sie ein vielversprechender Baustein für zukünftige Ernährungskonzepte.
Das Unternehmen ProteinDistillery (ehemals Saccha) hat einen Prozess entwickelt, mit dem aus Nebenströmen der Bierproduktion Proteine für die Nahrungsmittelindustrie hergestellt werden können. Nach Angaben des Unternehmens wird im Vergleich zur Herstellung von pflanzlichen Proteinen weniger Wasser und weniger Fläche benötigt. Auch der CO2 Ausstoß ist vergleichsweise geringer. Hochrechnungen von ProteinDistillery kommen zu dem Schluss, dass der jährliche Eiweißbedarf von mehr als 6,2 Mio. Menschen alleine mit Proteinen aus Bierhefe aus deutscher Produktion gedeckt werden könnte. Durch dieses Koppelnutzungskonzept bietet sich die Chance, den Flächenbedarf für die Proteinherstellung zu reduzieren.
Ein Teil des weiteren Entwicklungsbedarfs erstreckt sich auf die Skalierung des Prozesses in den Pilotmaßstab sowie die Optimierung der Aufbereitung. Zudem werden Anwendungsmöglichkeiten bzw. Endprodukte unter Verwendung des Bierhefeproteins entwickelt. Es wird erwartet, dass die Rohstoffkosten für die Herstellung von Proteinen aus Bierhefe in Zukunft deutlich unter den heutigen Rohstoffkosten für vergleichbare pflanzliche Proteine, beispielsweise aus Nüssen, bleiben.
Aufbauend auf einer Projektförderung des MLR und einer Gründungsförderung des Landes Baden-Württembergs konnten Investoren gefunden wurden, die den Aufbau einer Produktionsstätte in Heilbronn ermöglichen.
Gewinnerin des Bioökonomie-Innovationspreises 2021 des Landes Baden-Württemberg.